Straubinger, 6.April2006
Zahnärzte setzten bereits vor 9000 Jahren den Bohrer an
Werkzeuge aus Feuerstein - Füllung nicht ausgeschlossen
Paris/London. (dpa) Bereits vor 9000 Jahren setzten Zahnärzte im heutigen Pakistan den Bohrer an. Das gehe aus Funden
im Gräberfeld von Mehrgarh in Belutschistan hervor, berichtet ein internationales Forscherteam in der britischen
Fachzeitschrift "Nature" (Bd. 440, S. 755) vom Donnerstag. Zuvor waren nur Fälle nachgewiesen worden, die jünger als
6000 Jahre sind.
In 11 der mehr als 300 steinzeitlichen Gräber an einer Verkehrsachse zwischen Afghanistan und dem Industal fanden die Forscher Backenzähne mit eindeutigen Bohrlöchern. Einige Höhlungen waren nachgearbeitet.
Als Werkzeug benutzten die Steinzeit-Zahnärzte Feuerstein, wie er auch für Pfeilspitzen genutzt
wurde. Die waren erstaunlich effizient: Um ähnliche Löcher zu bohren, benötigten die Forscher
mit einem nachgebauten Flintstein-Bohrer weniger als eine Minute.
Forscher Backenzähne mit eindeutigen Bohrlöchern. Einige Höhlungen waren nachgearbeitet.
Als Werkzeug benutzten die Steinzeit-Zahnärzte Feuerstein, wie er auch für Pfeilspitzen genutzt
wurde. Die waren erstaunlich effizient: Um ähnliche Löcher zu bohren, benötigten die Forscher
mit einem nachgebauten Flintstein-Bohrer weniger als eine Minute.
Die Steinzeit-Ärzte bohrten nach Angaben des Teams um Roberto Macchiarelli von der
französischen Universität Poitiers bei Männern wie bei Frauen und im Ober- wie im Unterkiefer.
Abnutzungsspuren zeigten, dass die Menschen von Mehrgarh die Zähne nach der Behandlung
weiter zum Kauen benutzen. Es ging also nicht um kultische Handlungen an Toten. Zahnfüllungen
waren nach der langen Zeit nicht nachweisbar, werden aber nicht ausgeschlossen. Dennoch
sehen die Forscher den medizinischen Zweck der Behandlung nicht als völlig erwiesen an. Denn
Karies wurde auch bei unbehandelten Zähnen gefunden und es ist möglich, dass auch gesunde
Zähne angebohrt wurden.
Straubinger, Ostern 2006
Das Rätsel ist gelöst
Staubring des Saturns wird durch Vulkan eines Mondes gespeist
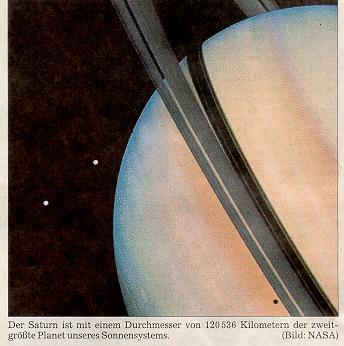 Als "Herr der Ringe" wird er oft bezeichnet: der Saturn. Den
zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems umkreisen prächtige
Ringe, die man selbst mit einfachen Teleskopen von der Erde aus
beobachten kann. Erst in den 60er Jahren entdeckten Astronomen
einen weiteren Ring, den so genannten E-Ring. Zwar extrem dünn,
ist er der größte planetare Ring im ganzen Sonnensystem.
Als "Herr der Ringe" wird er oft bezeichnet: der Saturn. Den
zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems umkreisen prächtige
Ringe, die man selbst mit einfachen Teleskopen von der Erde aus
beobachten kann. Erst in den 60er Jahren entdeckten Astronomen
einen weiteren Ring, den so genannten E-Ring. Zwar extrem dünn,
ist er der größte planetare Ring im ganzen Sonnensystem.
Anders als die klassischen Ringe, die aus zentimeter- bis
metergroßen Gesteinsbrocken bestehen, enthält dieser Ring nur
winzige Staubteilchen, erklärt Prof. Dr. Alexander Krivov von der
Friedrich-Schiller-Universität Jena. Dieser ausgedehnte staubige
Ring um Saturn gab dem Jenaer Experten für kosmischen Staub
und seinen Forscherkollegen seit seiner Entdeckung Rätsel auf.
Denn dass sich gerade einmal einen Mikrometer große
Staubteilchen dauerhaft zu einem Ring anordnen, ist ungewöhnlich.
"Normalerweise ist die Lebensdauer derart winziger Teilchen sehr
kurz", erklärt Prof. Krivov. In kosmischen Maßstäben bedeutet
das maximal 100 Jahre. Deshalb vermuteten die Forscher, dass
der Staubring des Saturns aus einer unbekannten Quelle ständig
neu gespeist werden muss, um dauerhaft zu bestehen.
Dieser bislang unbekannten Quelle ist ein internationales Forscherteam unter Beteiligung Krivovs jetzt auf die Spur
gekommen. Wie die Wissenschaftler im namhaften Joumal " Science" veröffentlichten, schleudert ein Vulkan am Südpol des
Saturnmondes Enceladus Staubteilchen und Wasserdampf in die Höhe. Er sorgt so dafür, dass sich der Staubring um Saturn
stetig erneuert. Diesen ungewöhnlichen Vulkan entdeckte die NASA-Raumsonde Cassini während ihres Vorbeifluges an
Enceladus (Durchmesser rund 499 Kilometer) am 14. Juli 2005. Während sich die Sonde dem Saturnmond bis auf 170
Kilometer näherte, konnte der an Bord befindliche Staubdetektor den Ausstoß der Staubteilchen nachweisen. Diesen so
genannten Cosmic Dust Analyzer haben deutsche Forscher vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg
entwickelt.
"Die Entdeckung der Staubquelle auf Enceladus war für die Fachwelt eine Sensation", schwärmt Prof. Krivov, der selbst
zunächst eine andere Erklärung für den Saturnstaub vermutete. Der russische Astrophysiker, der seit Dezember 2004 an der
Universität Jena tätig ist, hat bereits an der Galileo-Mission zum Jupiter mitgearbeitet und Staubringe um diesen Planeten
erforscht. "Dort ist es so, dass hauptsächlich Einschläge kleiner Meteoriten auf Monden Staub aufwirbeln." Das passiert auf
den Saturnmonden zwar auch, wie Krivov inzwischen weiß. "Im Vergleich zu den Staubmengen, die Enceladus abgibt, fällt
das aber kaum ins Gewicht", erklärt der Wissenschaftler.

Neurobiologie: Regiezellen im Hirn haben eigenes Netzwerk
Hierarchien auch im Hirn
VDI nachrichten, Heidelberg, 13. 4. 06, ber -
Bei Mensch und Maus ist es die graue Substanz im Gehirn, die dem Organismus befiehlt, was er zu tun hat. Doch wer
steuert eigentlich das Gehirn? Nicht alle Hirnzellen sind gleichberechtigt, es gibt regelrechte Regiezellen dort, ergaben die
Forschungen der Neurobiologin Prof. Hannah Monyer von der Universität Heidelberg. Diese so genannten Interneurone
leiten den Informationsfluss in geordnete Bahnen. Dafür erhält sie den diesjährigen Philip-Morris-Forschungspreis.
Während die normale Informationsverarbeitung in den Händen der normalen Neuronen liegt, übernehmen die Interneuronen,
die bis zu 20 % der Hirnzellen stellen, die Steuerung des Denkvorgangs. Sie stehen über ein ultraschnelles Netzwerk auf
Basis elektrischer Impulse miteinander in Verbindung, während die normalen Neuronen, deutlich langsamer, über chemische
Botenstoffe kommunizieren.
Um ein lebendes Gehirn beim Denken zu beobachten, markierte Monyer die Interneuronen mit dem fluoreszierenden
Farbstoff einer pazifischen Qualle. "So können wir Zellen im Gehirn wiederfinden und mit elektrischen Kontakten versehen",
erklärt sie.
Jedes Interneuron kontrolliert bis zu 500 Neuronen - nur wenige sogar noch mehr. Bei Lebewesen mit Verhaltensstörungen
zeigt das Zusammenspiel der Interneuronen auffällige Abweichungen. Die Regiezellen geraten aus dem Takt. Monyer
vermutet, dass Depression und Autismus ähnliche Ursachen haben könnten. B. SCHÖNE/ber
zurück
 Forscher Backenzähne mit eindeutigen Bohrlöchern. Einige Höhlungen waren nachgearbeitet.
Als Werkzeug benutzten die Steinzeit-Zahnärzte Feuerstein, wie er auch für Pfeilspitzen genutzt
wurde. Die waren erstaunlich effizient: Um ähnliche Löcher zu bohren, benötigten die Forscher
mit einem nachgebauten Flintstein-Bohrer weniger als eine Minute.
Forscher Backenzähne mit eindeutigen Bohrlöchern. Einige Höhlungen waren nachgearbeitet.
Als Werkzeug benutzten die Steinzeit-Zahnärzte Feuerstein, wie er auch für Pfeilspitzen genutzt
wurde. Die waren erstaunlich effizient: Um ähnliche Löcher zu bohren, benötigten die Forscher
mit einem nachgebauten Flintstein-Bohrer weniger als eine Minute.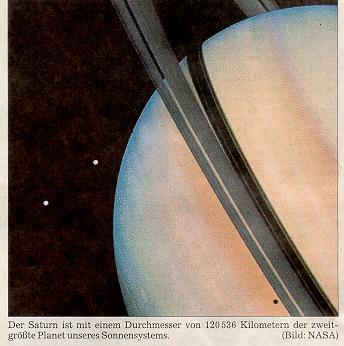 Als "Herr der Ringe" wird er oft bezeichnet: der Saturn. Den
zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems umkreisen prächtige
Ringe, die man selbst mit einfachen Teleskopen von der Erde aus
beobachten kann. Erst in den 60er Jahren entdeckten Astronomen
einen weiteren Ring, den so genannten E-Ring. Zwar extrem dünn,
ist er der größte planetare Ring im ganzen Sonnensystem.
Als "Herr der Ringe" wird er oft bezeichnet: der Saturn. Den
zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems umkreisen prächtige
Ringe, die man selbst mit einfachen Teleskopen von der Erde aus
beobachten kann. Erst in den 60er Jahren entdeckten Astronomen
einen weiteren Ring, den so genannten E-Ring. Zwar extrem dünn,
ist er der größte planetare Ring im ganzen Sonnensystem.